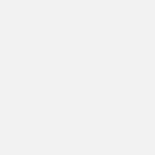809
A Romanesque engraved bronze dish
Copper alloy with shiny dark brown patina and minor verdigris. Shallow turned, chased and chiselled bowl with a concave raised rim, folded and bent edge. The well fully engraved with a demi-figure with head turned to the right and the inscription "SVPERBIA", framed by four rings of braided ornament. Grouped radially around it three busts with engraved inscriptions: "IDOL(A)TRIA" (idolatry), "INVIDIA" (envy), "IRA" (anger) and "(L)UXURIA" (hedonism), many letters emphasised by double strokes. The rim with three further large foliate ornaments with illegible inscriptions. With a bail soldered to the underside. H 6, diameter 32.7 cm.
Germany (possibly Saxony), 12th C.
This dish belongs to the group of objects that used to be known as Hanseatic bowls. These are bronze or copper vessels, generally from the 12th and 13th centuries, which, according to medieval manuscripts, were associated with the Hanseatic cities. They originate mainly from the region that stretched from the Baltic Sea across the Lower Rhine to England and was dominated by trade with the free cities. The designation of the Hansa bowls has been obsolete since the publication of the legendary art historian Weitzmann-Fiedler, who proved in 1981 that these objects in fact have no verifiable connection with the Hanseatic cities at all.
However, this bowl clearly belongs to the group known as the vice bowls, even if "idolatria" - emphasised here - cannot technically be assigned to the canon of the seven Christian deadly sins. Ulrich Müller describes this type as "bowls with incorrect iconography or even faulty inscriptions". He surmises that the utensils, which were probably used for hand washing, not only demonstrated social prestige, but also conveyed basic religious knowledge. "The topic of good and evil was present in everyday preaching practice. The hand washing seems (...) to have offered the opportunity to introduce this content during the meal, perhaps also when greeting or bidding farewell to visitors, and to demonstrate it on the part of the users." (ibid. p. 42)
Provenance
Archaeological find from the surroundings of Bautzen, Oberlausitz, recovered in 1947, subsequently in family ownership.
Literature
This type published in Müller, Gravierte romanische Bronzeschalen und Schachfiguren des 11./12. Jahrhunderts, in: Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 9.1998, p. 39 ff., ill. of the type p. 41.
S.a. Weitzmann-Fiedler, Romanische gravierte Bronzeschalen, Berlin 1981.
S.a. Müller, Zwischen Gebrauch und Bedeutung: Studien zur Funktion von Sachkultur am Beispiel mittelalterlichen Handwaschgeschirrs, Bonn 2006.
Two further, identically crafted, female allegories of vices in the collection of The Metropolitan Museum of Art New York, inv. no. 65.89. and in the Germanisches Nationalmuseum Nuremberg (in Mende, Die mittelalterlichen Bronzen, Nuremberg 2013, no. 100).
Kupferlegierung, mit lüstrierender dunkelbrauner Patina und wenig Grünspan. Im Zentrum abgedrehte, getriebene und ziselierte flache Schale mit konkav hochgezogener Fahne, umgebogenem und geknicktem Rand. Der Spiegel komplett mit Gravuren gefüllt. Zentral eine Halbfigur mit nach rechts gewandtem Kopf mit der Bezeichnung "SVPERBIA", gerahmt von vier stilisierten Kordelkränzen. Radial darum gruppiert drei Büsten mit gravierten Inschriften: "IDOL(A)TRIA" (Vergötterung), "INVIDIA" (Neid), "IRA" (Zorn) und "(L)UXURIA" (Genusssucht), viele Buchstaben betont durch Doppelstriche. Im Bereich der Fahne drei weitere große Blattornamente mit unleserlichen Inschriften. Auf dem Boden angelötete Aufhängeöse. H 6, Durchmesser 32,7 cm.
Deutsch (Sachsen?), 12. Jh.
Diese Schale gehört zur Gruppe der früher sogenannten Hansaschüsseln. Dabei handelt es sich um Bronze- oder Kupfergefäße gemeinhin aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die, überliefert durch mittelalterliche Handschriften, mit den Hansestädten in Verbindung gebracht werden. Sie stammen überwiegend aus der Region, die sich vom Baltischen Meer über den Niederrhein bis nach England erstreckte und die vom Handel der freien Städte dominiert wurde. Die Bezeichnung der Hansaschüsseln ist obsolet seit der Publikation der legendären Kunsthistorikerin Weitzmann-Fiedler, die 1981 nachwies, dass diese Objekte in keinem belegbaren Zusammenhang mit Hanse-Städten stehen.
Ganz klar aber ist diese Schale der Gruppe der Laster-Schalen zugehörig, wenn auch die hier betont formulierte "idolatria" nicht in den Kanon der sieben christlichen Hauptlaster einzuordnen ist. Ulrich Müller beschreibt diesen Typus als "Schalen mit falscher Ikonographie oder gar fehlerhaften Inschriften". Er vermutet, dass die wohl für Handwaschungen genutzten Geräte nicht nur Sozialprestige demonstrierten, sondern auch religiöses Basiswissen vermittelten. "Der Themenbereich durch Gut und Böse war durch alltägliche Predigtpraxis präsent. Die Handwaschung scheint (...) die Möglichkeit geboten zu haben, diese Inhalte beim Mahl, vielleicht auch bei Begrüßung oder Abschied einzuführen und seitens der Benutzer zu demonstrieren." (ibd. S. 42)
Provenienz
Bodenfund aus der Umgebung von Bautzen, Oberlausitz, um 1947, seit damals im Besitz der Familie.
Literatur
Der Typus bei Müller, Gravierte romanische Bronzeschalen und Schachfiguren des 11./12. Jahrhunderts, in: Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 9.1998, S. 39 ff., Abb. des Typus S. 41.
S.a. Weitzmann-Fiedler, Romanische gravierte Bronzeschalen, Berlin 1981.
S.a. Müller, Zwischen Gebrauch und Bedeutung: Studien zur Funktion von Sachkultur am Beispiel mittelalterlichen Handwaschgeschirrs, Bonn 2006.
Zwei weitere, gleich gearbeitete weibliche Lasterschalen in der Sammlung The Metropolitan Museum of Art New York, Inv. Nr. 65.89. und im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (bei Mende, Die mittelalterlichen Bronzen, Nürnberg 2013, Nr. 100).
Copper alloy with shiny dark brown patina and minor verdigris. Shallow turned, chased and chiselled bowl with a concave raised rim, folded and bent edge. The well fully engraved with a demi-figure with head turned to the right and the inscription "SVPERBIA", framed by four rings of braided ornament. Grouped radially around it three busts with engraved inscriptions: "IDOL(A)TRIA" (idolatry), "INVIDIA" (envy), "IRA" (anger) and "(L)UXURIA" (hedonism), many letters emphasised by double strokes. The rim with three further large foliate ornaments with illegible inscriptions. With a bail soldered to the underside. H 6, diameter 32.7 cm.
Germany (possibly Saxony), 12th C.
This dish belongs to the group of objects that used to be known as Hanseatic bowls. These are bronze or copper vessels, generally from the 12th and 13th centuries, which, according to medieval manuscripts, were associated with the Hanseatic cities. They originate mainly from the region that stretched from the Baltic Sea across the Lower Rhine to England and was dominated by trade with the free cities. The designation of the Hansa bowls has been obsolete since the publication of the legendary art historian Weitzmann-Fiedler, who proved in 1981 that these objects in fact have no verifiable connection with the Hanseatic cities at all.
However, this bowl clearly belongs to the group known as the vice bowls, even if "idolatria" - emphasised here - cannot technically be assigned to the canon of the seven Christian deadly sins. Ulrich Müller describes this type as "bowls with incorrect iconography or even faulty inscriptions". He surmises that the utensils, which were probably used for hand washing, not only demonstrated social prestige, but also conveyed basic religious knowledge. "The topic of good and evil was present in everyday preaching practice. The hand washing seems (...) to have offered the opportunity to introduce this content during the meal, perhaps also when greeting or bidding farewell to visitors, and to demonstrate it on the part of the users." (ibid. p. 42)
Provenance
Archaeological find from the surroundings of Bautzen, Oberlausitz, recovered in 1947, subsequently in family ownership.
Literature
This type published in Müller, Gravierte romanische Bronzeschalen und Schachfiguren des 11./12. Jahrhunderts, in: Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 9.1998, p. 39 ff., ill. of the type p. 41.
S.a. Weitzmann-Fiedler, Romanische gravierte Bronzeschalen, Berlin 1981.
S.a. Müller, Zwischen Gebrauch und Bedeutung: Studien zur Funktion von Sachkultur am Beispiel mittelalterlichen Handwaschgeschirrs, Bonn 2006.
Two further, identically crafted, female allegories of vices in the collection of The Metropolitan Museum of Art New York, inv. no. 65.89. and in the Germanisches Nationalmuseum Nuremberg (in Mende, Die mittelalterlichen Bronzen, Nuremberg 2013, no. 100).
Kupferlegierung, mit lüstrierender dunkelbrauner Patina und wenig Grünspan. Im Zentrum abgedrehte, getriebene und ziselierte flache Schale mit konkav hochgezogener Fahne, umgebogenem und geknicktem Rand. Der Spiegel komplett mit Gravuren gefüllt. Zentral eine Halbfigur mit nach rechts gewandtem Kopf mit der Bezeichnung "SVPERBIA", gerahmt von vier stilisierten Kordelkränzen. Radial darum gruppiert drei Büsten mit gravierten Inschriften: "IDOL(A)TRIA" (Vergötterung), "INVIDIA" (Neid), "IRA" (Zorn) und "(L)UXURIA" (Genusssucht), viele Buchstaben betont durch Doppelstriche. Im Bereich der Fahne drei weitere große Blattornamente mit unleserlichen Inschriften. Auf dem Boden angelötete Aufhängeöse. H 6, Durchmesser 32,7 cm.
Deutsch (Sachsen?), 12. Jh.
Diese Schale gehört zur Gruppe der früher sogenannten Hansaschüsseln. Dabei handelt es sich um Bronze- oder Kupfergefäße gemeinhin aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die, überliefert durch mittelalterliche Handschriften, mit den Hansestädten in Verbindung gebracht werden. Sie stammen überwiegend aus der Region, die sich vom Baltischen Meer über den Niederrhein bis nach England erstreckte und die vom Handel der freien Städte dominiert wurde. Die Bezeichnung der Hansaschüsseln ist obsolet seit der Publikation der legendären Kunsthistorikerin Weitzmann-Fiedler, die 1981 nachwies, dass diese Objekte in keinem belegbaren Zusammenhang mit Hanse-Städten stehen.
Ganz klar aber ist diese Schale der Gruppe der Laster-Schalen zugehörig, wenn auch die hier betont formulierte "idolatria" nicht in den Kanon der sieben christlichen Hauptlaster einzuordnen ist. Ulrich Müller beschreibt diesen Typus als "Schalen mit falscher Ikonographie oder gar fehlerhaften Inschriften". Er vermutet, dass die wohl für Handwaschungen genutzten Geräte nicht nur Sozialprestige demonstrierten, sondern auch religiöses Basiswissen vermittelten. "Der Themenbereich durch Gut und Böse war durch alltägliche Predigtpraxis präsent. Die Handwaschung scheint (...) die Möglichkeit geboten zu haben, diese Inhalte beim Mahl, vielleicht auch bei Begrüßung oder Abschied einzuführen und seitens der Benutzer zu demonstrieren." (ibd. S. 42)
Provenienz
Bodenfund aus der Umgebung von Bautzen, Oberlausitz, um 1947, seit damals im Besitz der Familie.
Literatur
Der Typus bei Müller, Gravierte romanische Bronzeschalen und Schachfiguren des 11./12. Jahrhunderts, in: Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 9.1998, S. 39 ff., Abb. des Typus S. 41.
S.a. Weitzmann-Fiedler, Romanische gravierte Bronzeschalen, Berlin 1981.
S.a. Müller, Zwischen Gebrauch und Bedeutung: Studien zur Funktion von Sachkultur am Beispiel mittelalterlichen Handwaschgeschirrs, Bonn 2006.
Zwei weitere, gleich gearbeitete weibliche Lasterschalen in der Sammlung The Metropolitan Museum of Art New York, Inv. Nr. 65.89. und im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (bei Mende, Die mittelalterlichen Bronzen, Nürnberg 2013, Nr. 100).
Decorative Arts
Sale Date(s)
Venue Address
Noch keine Versandinformationen verfügbar.
Shipping information not yet avalable.
Important Information
Auktion 1244 - Kunstgewerbe - Silber, Porzellan, Keramik
Mittwoch 15. 05. 2024, 10:00
Lot 400 - 808
Auktion 1244 - Kunstgewerbe - Kunstkammerobjekte, Möbel, Dekoration
Mittwoch 15. 05. 2024, 16:00
Lot 809 - 941
Auktion 1244
Terms & Conditions
1. Die Kunsthaus Lempertz KG (im Nachfolgenden Lempertz) versteigert öffentlich im Sinne des § 383 Abs. 3 Satz 1 HGB als Kommissionär für Rechnung der Einlieferer, die unbenannt bleiben. Im Verhältnis zu Abfassungen der Versteigerungsbedingungen in anderen Sprachen ist die deutsche Fassung maßgeblich.
2. Lempertz behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen und, wenn ein besonderer Grund vorliegt, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Objekte können im Rahmen der Vorbesichtigung geprüft und besichtigt werden. Die Katalogangaben und entsprechende Angaben der Internetpräsentation, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, werden nicht Bestandteil der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit. Sie beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Katalogbearbeitung herrschenden Stand der Wissenschaft. Sie sind keine Garantien im Rechtssinne und dienen ausschließlich der Information. Gleiches gilt für Zustandsberichte und andere Auskünfte in mündlicher oder schriftlicher Form. Zertifikate oder Bestätigungen der Künstler, ihrer Nachlässe oder der jeweils maßgeblichen Experten sind nur dann Vertragsgegenstand, wenn sie im Katalogtext ausdrücklich erwähnt werden. Der Erhaltungs zustand wird im Katalog nicht durchgängig erwähnt, so dass fehlende Angaben ebenfalls keine Beschaffenheitsvereinbarung begründen. Die Objekte sind gebraucht. Alle Objekte werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden.
4. Ansprüche wegen Gewährleistung sind ausgeschlossen. Lempertz verpflichtet sich jedoch bei Abweichungen von den Katalogangaben, welche den Wert oder die Tauglichkeit aufheben oder nicht unerheblich mindern, und welche innerhalb eines Jahres nach Übergabe in begründeter Weise vorgetragen werden, seine Rechte gegenüber dem Einlieferer gerichtlich geltend zu machen. Maßgeblich ist der Katalogtext in deutscher Sprache. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet Lempertz dem Erwerber ausschließlich den gesamten Kaufpreis. Darüber hinaus verpflichtet sich Lempertz für die Dauer von drei Jahren bei erwiesener Unechtheit zur Rückgabe der Kommission, wenn das Objekt in unverändertem Zustand zurückgegeben wird. Die gebrauchten Sachen werden in einer öffentlichen Versteigerung verkauft, an der der Bieter/Käufer persönlich teilnehmen kann. Die Regelungen über den Verbrauchsgüterverkauf finden nach § 474 Abs. 1 Satz 2 BGB keine Anwendung.
5. Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund eines Mangels, eines Verlustes oder einer Beschädigung des versteigerten Objektes, gleich aus welchem Rechtsgrund, oder wegen Abweichungen von Katalogangaben oder anderweitig erteilten Auskünften und wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten nach §§ 41 ff. KGSG sind ausgeschlossen, sofern Lempertz nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder vertragswesentliche Pflichten verletzt hat; die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Im Übrigen gilt Ziffer 4.
6. Abgabe von Geboten. Lempertz behält sich die Zulassung zur Auktion vor und kann diese insbesondere von der erfolgreichen Identifizierung im Sinne von § 1 Abs. 3 des GWG abhängig machen. Gebote in Anwesenheit: Der Bieter erhält gegen Vorlage seines Lichtbildausweises eine Bieternummer. Ist der Bieter Lempertz nicht bekannt, hat die Anmeldung 24 Stunden vor Beginn der Auktion schriftlich und unter Vorlage einer aktuellen Bankreferenz zu erfolgen. Gebote in Abwesenheit: Gebote können auch schriftlich, telefonisch oder über das Internet abgegeben werden. Aufträge für Gebote in Abwesenheit müssen Lempertz zur ordnungsgemäßen Bearbeitung 24 Stunden vor der Auktion vorliegen. Das Objekt ist in dem Auftrag mit seiner Losnummer und der Objektbezeichnung zu benennen. Bei Unklarheiten gilt die angegebene Losnummer. Der Auftrag ist vom Aufraggeber zu unterzeichnen. Die Bestimmungen über Widerrufsund Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen (§ 312bd BGB) finden keine Anwendung. Telefongebote: Für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung der Verbindung kann nicht eingestanden werden. Mit Abgabe des Auftrages erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass der Bietvorgang aufgezeichnet werden kann. Gebote über das Internet: Sie werden von Lempertz nur angenommen, wenn der Bieter sich zuvor über das Internetportal registriert hat. Die Gebote werden von Lempertz wie schriftlich abgegebene Gebote behandelt.
7. Durchführung der Auktion: Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebotes kein höheres Gebot abgegeben wird. Der Versteigerer kann sich den Zuschlag vorbehalten oder verweigern, wenn ein besonderer Grund vorliegt, insbesondere wenn der Bieter nicht im Sinne von § 1 Abs. 3 GWG erfolgreich identifiziert werden kann. Wenn mehrere Personen zugleich dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den erteilten Zuschlag zurücknehmen und die Sache erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen und dies vom Bieter sofort beanstandet worden ist oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. Schriftliche Gebote werden von Lempertz nur in dem Umfang ausgeschöpft, der erforderlich ist, um ein anderes Gebot zu überbieten. Der Versteigerer kann für den Einlieferer bis zum vereinbarten Limit bieten, ohne dies anzuzeigen und unabhängig davon, ob andere Gebote abgegeben werden. Wenn trotz abgegebenen Gebots kein Zuschlag erteilt worden ist, haftet der Versteigerer dem Bieter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.lempertz.com/datenschutzerklärung.html
8. Mit Zuschlag kommt der Vertrag zwischen Versteigerer und Bieter zustande (§ 156 S. 1 BGB). Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Sofern ein Zuschlag unter Vorbehalt erteilt wurde, ist der Bieter an sein Gebot bis vier Wochen nach der Auktion gebunden, wenn er nicht unverzüglich nach Erteilung des Zuschlages von dem Vorbehaltszuschlag zurücktritt. Mit der Erteilung des Zuschlages gehen Besitz und Gefahr an der versteigerten Sache unmittelbar auf den Bieter/Ersteigerer über, das Eigentum erst bei vollständigem Zahlungseingang.
9. Auf den Zuschlagspreis wird ein Aufgeld von 26 % zuzüglich 19 % Umsatzsteuer nur auf das Aufgeld erhoben, auf den über € 600.000 hinausgehenden Betrag reduziert sich das Aufgeld auf 20 % (Differenzbesteuerung). Bei differenzbesteuerten Objekten, die mit N gekennzeichnet sind, wird zusätzlich die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 7 % berechnet. Für Katalogpositionen, die mit R gekennzeichnet sind, wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 % auf den Zuschlagspreis + Aufgeld berechnet (Regelbesteuerung). Wird ein regelbesteuertes Objekt an eine Person aus einem anderen Mitgliedsstaat der EU, die nicht Unternehmer ist, verkauft und geliefert, kommen die umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften des Zielstaates zur Anwendung, § 3c UStG. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) und – bei Angabe der UmsatzsteuerIdentifikationsnummer – auch an Unternehmen in EU-Mitgliedsstaaten. Für Originalkunstwerke, deren Urheber noch leben oder vor weniger als 70 Jahren (§ 64 UrhG) verstorben sind, wird zur Abgeltung des gemäß § 26 UrhG zu entrichtenden Folgerechts eine Gebühr in Höhe von 1,8 % auf den Hammerpreis erhoben. Bei Zahlungen über einem Betrag von € 10.000,00 ist Lempertz gemäß §3 des GWG verpflichtet, die Kopie eines Lichtbildausweises des Käufers zu erstellen. Dies gilt auch, wenn eine Zahlung für mehrere Rechnungen die Höhe von € 10.000,00 überschreitet. Nehmen Auktionsteilnehmer ersteigerte Objekte selbst in Drittländer mit, wird ihnen die Umsatzsteuer erstattet, sobald Lempertz Ausfuhr und Abnehmernachweis vorliegen. Während der unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum vorbehalten.
10. Ersteigerer haben den Endpreis (Zuschlagspreis zuzüglich Aufgeld + MwSt.) im unmittelbaren Anschluss an die Auktion an Lempertz zu zahlen. Zahlungen sind in Euro zu tätigen. Eine Zahlung mit Kryptowährungen ist möglich. Die Rechnung wird per Email übermittelt, es sei denn, der Ersteigerer äußert den Wunsch, diese per Post zu erhalten. Der Antrag auf Änderung oder Umschreibung einer Rechnung, z.B. auf einen anderen Kunden als den Bieter, muss unmittelbar im Anschluss an die Auktion abgegeben werden. Durch die Änderung können zusätzliche Gebühren anfallen. Die Umschreibung erfolgt unter Vorbehalt der erfolgreichen Identifizierung (§ 1 Abs. 3 GWG) des Bieters und derjenigen Person, auf die die Umschreibung der Rechnung erfolgt. Rechnungen werden nur an diejenigen Personen ausgestellt, die die Rechnung tatsächlich begleichen.
11. Bei Zahlungsverzug werden 1 % Zinsen auf den Bruttopreis pro Monat berechnet. Lempertz kann bei Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages oder nach Fristsetzung Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache nochmals versteigert wird und der säumige Ersteigerer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung und für die Kosten der wiederholten Versteigerung einschließlich des Aufgeldes einzustehen hat.
12. Die Ersteigerer sind verpflichtet, ihre Erwerbung sofort nach der Auktion in Empfang zu nehmen. Lempertz haftet für versteigerte Objekte nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Ersteigerte Objekte werden erst nach vollständigem Zahlungseingang ausgeliefert. Eine Versendung erfolgt ausnahmslos auf Kosten und Gefahr des Ersteigerers. Lempertz ist berechtigt, nicht abgeholte Objekte vier Wochen nach der Auktion im Namen und auf Rechnung des Ersteigerers bei einem Spediteur einlagern und versichern zu lassen. Bei einer Selbsteinlagerung durch Lempertz werden 1 % p.a. des Zuschlagspreises für Versicherungs- und Lagerkosten berechnet.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand, sofern er vereinbart werden kann, ist Köln. Es gilt deutsches Recht; Das Kulturgutschutzgesetz wird angewandt. Das UN-Übereinkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. Es wird auf die Datenschutzerklärung auf unserer Webpräsenz hingewiesen.